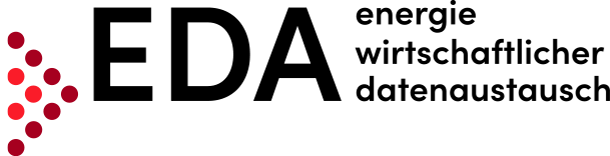Energiegemeinschaften
Gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen (GEA)
Selbstständige Energieversorgung für Mehrparteienhäuser
GEA stehen für einen weiteren Schritt in Richtung Energiewende. Mehrparteienhäuser können im Sinne der Nachhaltigkeit an der Stromproduktion teilnehmen – die Konsumenten werden zu Produzenten (Prosumer). Für eine GEA kommen neben Photovoltaik beispielsweise auch Windkraftanlagen oder Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in Frage.
Entsprechend dem Gesetzeswortlaut sind die Mieter oder Eigentümer sogenannte „teilnehmende Berechtigte“ (Teilnehmer). Von den Teilnehmern ist gegenüber dem Netzbetreiber ein „Betreiber der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage“ (Betreiber) zu benennen. Das Anwenderportal ist das bevorzugte Werkzeug für Betreiber der GEA, um den energiewirtschaftlichen Datenaustausch durchführen zu können.
Wie funktionieren gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen?
Der Vertrag zwischen dem Betreiber einer GEA und den Teilnehmern regelt, zu welchen Bedingungen Strom aus der Anlage bezogen werden kann und wie der Ertrag zwischen dem Betreiber und den Teilnehmern verteilt wird, wenn überschüssiger Strom ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Ein Smart Meter ist für die Teilnahme erforderlich. Damit die Zuordnung und Abrechnung des Stroms korrekt erfolgen kann, müssen alle Teilnehmer ihre Zustimmung zur Erfassung und Übertragung von Viertelstundenwerten geben.
Der Betreiber hat dem Netzbetreiber den Modus zur Aufteilung der erzeugten Strommengen auf die Teilnehmer mitzuteilen. Mehr Informationen zu den Aufteilungsmodellen (statisch und dynamisch) und zur Verrechnung unter den Teilnehmern finden Sie im Factsheet Gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen von Oesterreichs Energie
und in der Broschüre vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.
Erneuerbare-Energiegemeinschaften (EEG)
Dezentrale Energieversorgung in einem Stromnetz
Teilnehmer an EEG können sich nicht nur innerhalb von Objekten, sondern auch innerhalb eines lokalen oder regionalen Nahbereichs über das öffentliche Stromnetz zusammenschließen.
Der maßgebliche Unterschied zu den gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen ist, dass die Erzeugungsanlage und die Teilnehmer über das öffentliche Netz verbunden sind. Ebenfalls dürfen EEG verschiedene Arten von Energie (Strom, Wärme oder Gas) aus erneuerbaren Quellen erzeugen, speichern, verbrauchen und verkaufen.
Wie funktionieren Erneuerbare-Energiegemeinschaften?
Bei EEG werden zwei Formen unterschieden:
- Bei lokalen Nahbereichen sind die Teilnehmer über die Niederspannungs-Ortsnetzleitungen, die an einer Trafostation angeschlossen sind, verbunden.
- Bei regionalen Nahbereichen werden für die Verbindung der Teilnehmer auch Mittelspannungsleitungen zwischen mehreren Trafostationen in Anspruch genommen.
Mehr Informationen zur Funktionsweise von EEG finden Sie bei Oesterreichs Energie.
Für Detailinformationen, von der Gründung bis hin zum laufenden Betrieb, wenden Sie sich an die Beratungsstelle.
Bürger-Energiegemeinschaften (BEG)
Dezentrale Energieversorgung netzgebietübergreifend
Teilnehmer und Erzeugungsanlagen in BEG können sich nicht nur innerhalb von einem Stromnetz, sondern über mehrere Stromnetze hinweg zusammenschließen.
Der Unterschied zu den EEG ist, dass die Erzeugungsanlagen und die Teilnehmer über mehrere Konzessionsgebiete (Netzgebiete) verbunden sein können. Dadurch können Teilnehmer aus ganz Österreich an einer BEG teilnehmen und die Energiegemeinschaft ist nicht auf ein Netzgebiet beschränkt. Ebenfalls dürfen BEG nur elektrische Energie erzeugen, speichern, verbrauchen und verkaufen.
Für Detailinformationen, von der Gründung bis hin zum laufenden Betrieb, wenden Sie sich an die Beratungsstelle.
Aufteilungsmodelle
Das Grundkonzept besteht darin, dass den Teilnehmern die von den Erzeugungsanlagen erzeugte Energie anteilig zugerechnet und überschüssige Energie ins öffentliche Netz eingespeist wird. Die Zuordnung erfolgt über einen Aufteilungsschlüssel, der entweder statisch oder dynamisch sein kann. Es ist nur ein Aufteilungsschlüssel pro Energiegemeinschaft zulässig. Der Betreiber kann gemeinsam mit den Teilnehmern frei entscheiden, welches der beiden Aufteilungsmodelle sie wählen.
Statische Aufteilung
Statische Aufteilung bedeutet, dass jedem Teilnehmer immer der jeweils vereinbarte erzeugte Anteil zugeordnet wird. Verbraucht er ihn nicht, wird der Strom ins Netz abgegeben, geht also zurück auf die „Gemeinschaftsüberschussanlage“. Die zwischen den Teilnehmern und der Energiegemeinschaft fix vereinbarten Aufteilungsschlüssel können nach Wunsch einmal pro Jahr kostenlos verändert werden.
Dynamische Aufteilung
Dynamische Aufteilung bedeutet, dass durch die Erzeugungsanlagen erzeugte Energie so weit wie möglich bedarfsgerecht auf die Teilnehmer aufgeteilt wird, um den Grad der Eigenversorgung zu erhöhen. Auch in diesem Fall geht Überschuss der einzelnen Teilnehmer zurück auf die „Gemeinschaftsüberschussanlage“. Benötigt ein Teilnehmer gerade keinen Strom, wird der Strom den anderen Teilnehmern zugeordnet.


Verrechnung und Messung
Vom Netzbetreiber werden an die Energiegemeinschaft für den Abrechnungszeitraum folgende Werte zur Verfügung gestellt.
Erzeugungszählpunkt:
- Erzeugung laut Messung [KWH]
- Erzeugung lt. Messung entsprechend dem Teilnahmefaktor [KWH]
- Restüberschuss bei Energiegemeinschaft [KWH]
Verbrauchszählpunkt:
- Verbrauch lt. Messung [KWH]
- Verbrauch lt. Messung entsprechend dem Teilnahmefaktor [KWH]
- Anteil gemeinschaftlicher Erzeugung [KWH]
- Eigendeckung gemeinschaftliche Erzeugung [KWH]
- Eigendeckung aus erneuerbarer Energie [KWH]
Mit diesen Werten kann die transparente Abrechnung der Energiegemeinschaft mit den einzelnen Teilnehmern erfolgen.
Wie die Einnahmen aus diesen Überschüssen zwischen dem Betreiber und den Teilnehmern aufgeteilt werden, können diese untereinander frei vereinbaren. Auch wie die Kosten der Energiegemeinschaft geteilt werden, ist von den Teilnehmern und dem Betreiber untereinander festzulegen.
Zusätzliche Energie, die einzelne Teilnehmer aus dem öffentlichen Netz beziehen, wird weiterhin vom Energielieferanten und vom Netzbetreiber gemäß den jeweils geltenden Tarifen direkt an die Teilnehmer verrechnet. Basis für alle Verrechnungen sind jeweils die Daten, die von den Smart Metern oder dem Lastprofilzähler (LPZ) viertelstündlich geliefert werden.


Erforderliche Schritte für den Betrieb


- Errichtungs- und Betriebsvertrag
- Registrierung als Energiegemeinschaft auf ebUtilities.at
- Vereinbarung mit Netzbetreiber und Teilnehmer
- Anbindung an EDA über eine Anbindungsart


- Stammdatenerfassung der Erzeugungsanlagen / Teilnehmer
- Übermittlung der Zählpunkte von Teilnehmern an Netzbetreiber
- Übermittlung Aufteilungsschlüssel der Erzeugungsanlagen an Netzbetreiber


- Übermittlung der notwendigen Energiedaten aller Erzeugungsanlagen und Teilnehmer
- Bearbeitung / Aufbereitung der Daten für Abrechnung mit Teilnehmern
- Ggf. Durchführung der Abrechnung mit Teilnehmern
Voraussetzungen
Zur Teilnahme am energiewirtschaftlichen Datenaustausch muss sich die Energiegemeinschaft bei der Informationsplattform ebUtilities.at registrieren. Die Kennung (z.B. GC100006 bzw. RC100006 bzw. CC100006) wird im Zuge der Registrierung für die betroffene Rolle vergeben. Diese Kennung gilt als Identifikationsnummer für den gesamten weiteren Datenaustausch über EDA mit anderen Marktteilnehmern.
Hinweis für Bürgerenergiegemeinschaften: Information
Anbindungsarten
Für die Datenübertragung bzw. den Datenaustausch stehen für Energiegemeinschaften folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Anwenderportal (inklusive Prozessumgebung für die Nachrichtenversendung und -verarbeitung)
- E-Mail Anbindung (eigene Softwareapplikation für die Nachrichtenversendung und -verarbeitung erforderlich)
- Kommunikationsendpunkt (eigene IT-Landschaft und Softwareapplikation für die Nachrichtenversendung und -verarbeitung erforderlich)
Für Energiegemeinschaften wurde das Anwenderportal entwickelt, das Daten nicht nur sicher überträgt, sondern auch alle Informationen zu Datenübertragung und -sicherheit sowie umfassende Serviceleistungen bietet. Im Anwenderportal werden die von den Netzbetreibern übermittelten Nachrichten visualisiert und für die weitere Verwendung aufbereitet.
Relevante Prozesse
Hier zu den relevanten Marktprozessen (Kategorie "Energiegemeinschaften").
Beispielhafte Darstellung der Kommunikation